
Straßenansicht

Ansicht Traufseite
Altes Stadtbuch 1680: Nr. 1191 (Haus); vermutlich auch die Nrn. 1192, 1193 (Zuordnung unsicher)
Wasserleitungsplan 1710: ohne Wasserleitungsanschluss
Glashoff-Karte 1833: Nr. 487

Auszug Stadtbildatlas
1993
Grundstück und Bebauung
Das Grundstück liegt an der Ecke zur Großen Hohen Straße. Die Bebauung besteht heute nur aus dem breit gelagerten, zweigeschossigen Vorderhaus von sieben Achsen.
Auf der Glashoff-Karte 1833 ist das Gebäude in den heutigen Abmessungen dargestellt.Datierungen
- westliches Dach: 10 Proben, Eiche, davon 1 Probe „um 1437“
- mittleres Dach: 10 Proben, Kiefer, davon 1 Probe „Winter 1676/77“, 3 Proben „Winter 1682/83“ und 1 Probe „Winter 1683/84“
- östliches Dach: 14 Proben, Kiefer, davon 1 Probe „Winter 1759/60“, 3 Proben „Winter 1760/61“ und 1 Probe „Winter 1648/49“ (Bauholz aus Schweden)
Kurzbeschreibung und bauhistorische Wertung
Hinter der breit gelagerten Fassade stehen drei ältere Giebelhäuser, die an der im 19./20. Jh. veränderten Rückfassade noch erkennbar sind. Die Baugeschichte des gesamten Komplexes ist bisher nicht untersucht; erste Hinweise geben derzeit lediglich die dendrochronologischen Untersuchungen der Dachwerke.Danach ist im westlichen Giebelhaus noch mittelalterliche Bausubstanz aus dem 15. Jh. nachgewiesen (im Keller drei kreuzrippengewölbte Joche, 14.-1. Drittel 16. Jh.), während im mittleren Haus Umbauten des späten 17. Jh., im östlichen aus der Zeit um 1760 belegt sind.
Die klassizistische Fassade horizontal gegliedert durch Stockwerksgesims und kräftiges Hauptgesims, über den seitlichen Doppelachsen hohe Attiken. Im Bereich des dreiachsigen Mittelrisalits ein Halbgeschoss, eine niedrige Attika und ein Aufsatz mit Lünettenfenster und abschließendem Dreiecksgiebel. Das Haupteingangsportal mit Pilasterrahmung und Verdachung sitzt in der mittleren Achse. Ein weiterer Eingang an der Seitenfront zur Großen Hohen Straße: Barockportal mit flankierenden Pilastern und geschwungener Verdachung. Die drei Dachwerke vermutlich im Zusammenhang mit der Errichtung der klassizistischen Fassade abgewalmt, da sonst die Firstspitzen über der neuen Fassade zu sehen gewesen wären.
Das westliche Dach als Kehlbalkendach mit zwei Kehlbalkenlagen, 15 Gebinde, Dachneigung ca. 67 Grad. Die Firstverbindung geblattet, die Sparren-Kehlbalken-Verbindung als Hakenblatt mit Holznagel. Auf beiden Seiten gerissene Abbundzeichen in römischer Zählweise, auf der Ostseite mit zusätzlichem Diagonalstrich.
Das mittlere Dach als Kehlbalkendach mit zwei Kehlbalkenlagen, 17 Gebinde, Dachneigung ca. 53 Grad. Die Firstverbindung als Scherzapfen mit Holznagel, die Sparren-Kehlbalken-Verbindung als gerades Blatt mit Holz- und Fugennagel. Auf der Ostseite geschlagene Abbundzeichen, auf der Westseite geritzte Abbundzeichen mit Fähnchen, römische Zählweise.
Das östliche Dach als Mansarddach, 17 Gebinde, obere Dachneigung ca. 45 Grad, die untere Dachneigung aufgrund des Dachausbaus nicht bekannt. Die Firstverbindung als Scherzapfen mit Holznagel, die Sparren-Kehlbalken-Verbindung gezapft mit Holznagel. Auf der Ostseite geschlagene Abbundzeichen in römischer Zählweise im Sparrenfußbereich.
Eigentümer und Bewohner im 17. und 18. Jahrhundert
· Hans Sternberg
· Andreas Schulte (Kauf, 1634); Bürgerbuch: Andreas Schulte, 04.03.1629, Altflicker, Bürgersohn
· Jürgen Mehler (Kauf, 1650)
· Türkensteuerregister 1665: Peter Panring und Frau, 1 Reichstaler und 40 Schilling; der damalige Eigentümer, der Bootsmann Jurgen Mehler, zahlte für angrenzende Grundstücke „Gegen dem Königl. Hoffe“ 1 Reichstaler und 38 Schilling
· Peter Panring (Kauf, 1678); Bürgerbuch: Peter Panring, Schustergeselle, 13.1.1659
· dessen Erben (vermutlich vor 1694, nachgetragen)
· Jacob Zilmer (Zuweisung kraft Richterspruch, 1694); Bürgerbuch: Jacob Zelmer, 21.09.1694, Hake
· Johan Conrad Böhm (Erbe im Namen der Ehefrau)
· die Hebung zum Heiligen Geist (aus Konkurs, 1728)
· Joh. Erdtman Burmeister (Kauf, 1790)
· Herr Tribunals Assessor Joach. Friedr. Stemwebe (Kauf, 1790); Stemwebe wird 1790 auch Eigentümer der Nachbarhäuser (Altes Stadtbuch Nrn. 1192, 1193, 1194, 1195 und 1196. Er ist als Bauherr für den klassizistischen Umbau des Komplexes anzunehmen.Literatur und Quellen
· Georg Dehio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Mecklenburg-Vorpommern. Bearbeitet von Hans-Christian Feldmann. München/Berlin 2000, S. 700.
· Institut für Denkmalpflege (Hrsg.): Die Bau- und Kunstdenkmale in der DDR. Mecklenburgische Küstenregion. München 1990, S. 153 (dort unter Lübsche Str. 100)
· Akten der Hansestadt Wismar (Bauordnungs- und Denkmalamt, Stadtarchiv).
· Dendrochronologisches Gutachten der Universität Hamburg, Fachbereich Biologie, Dipl.-Holzwirt Sigrid Wrobel, Dezember 2002.
· Architekten, Ingenieure Pilote: Bestandszeichnungen M 1:50 (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), Rostock 2003.

Auszug Glashoff-Karte
1833
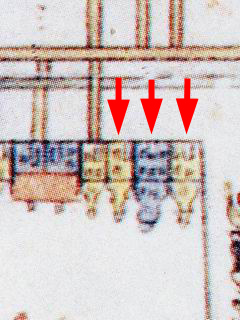
Auszug Wasserleitungsplan
1710
